Welche Vision kann uns retten? Wird alles gut?

Es nimmt nicht wunder, dass wir uns an positiven Gedanken orientieren wollen, wenn die Dunkelheit zu lange andauert:
“Unsere Gegenwart wird beherrscht von Gefahren. Die Aussicht ist düster. Höchste Zeit, den Blick wieder zu weiten, um Vorstellungen einer lohnenden Zukunft zu entwickeln: Postwachstum, Longtermism, freie Planwirtschaft, Metaverse – und welche dieser Welten überzeugt Sie?” fragt das Philosophiemagazin in seiner neuen Ausgabe. Und bietet zugleich eine Auswahl an lohnenden Zukunftsvisionen. Denn wir sollten unseren Blick weiten, um neue, andere, bessere Vorstellungen zuzulassen, meinen die Autoren. Alle Texte im Magazin und online in der Übersicht.
 Schon im vergangenen September hat Konrad Paul Liessmann das Thema für das diesjährige Philosophicum Lech geplant – wie immer prophetisch vorausschauend: “Alles wird gut. Zur Dialektik der Hoffnung” lautet es, denn: “Hoffnung war immer schon ein zweischneidiges Schwert. Hoffnung ist das, was bleibt, wenn nichts mehr getan werden kann. Hoffnung ist das Eingeständnis eines Scheiterns, das nur noch auf das Unverfügbare setzen kann: auf ein Wunder. Hoffnung ist aber auch das, was uns in finsteren Zeiten aufrecht hält und an eine Zukunft glauben lässt”, so Liessmann im Editorial.
Schon im vergangenen September hat Konrad Paul Liessmann das Thema für das diesjährige Philosophicum Lech geplant – wie immer prophetisch vorausschauend: “Alles wird gut. Zur Dialektik der Hoffnung” lautet es, denn: “Hoffnung war immer schon ein zweischneidiges Schwert. Hoffnung ist das, was bleibt, wenn nichts mehr getan werden kann. Hoffnung ist das Eingeständnis eines Scheiterns, das nur noch auf das Unverfügbare setzen kann: auf ein Wunder. Hoffnung ist aber auch das, was uns in finsteren Zeiten aufrecht hält und an eine Zukunft glauben lässt”, so Liessmann im Editorial.
Alles wird gut. Ob dieser Satz seine Berechtigung hat oder ironisch verstanden werden muss – darüber werden beim 26. Philosophicum Lech im September Vortragende aus Philosophie, Sozial- und Kulturwissenschaften und benachbarten Disziplinen referieren und mit dem Publikum diskutieren.
Möge uns das Sprichwort “Die Hoffnung stirbt zuletzt” möglichst nachhaltig stärken, wünscht uns allen – die Autorin des Blogs.

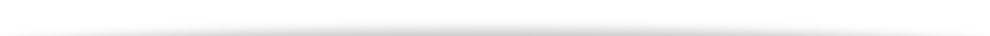
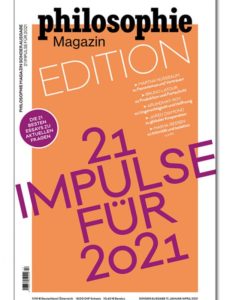
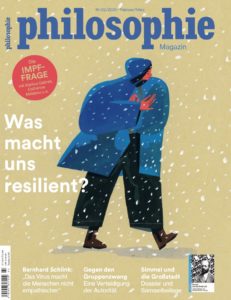
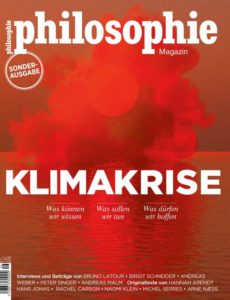
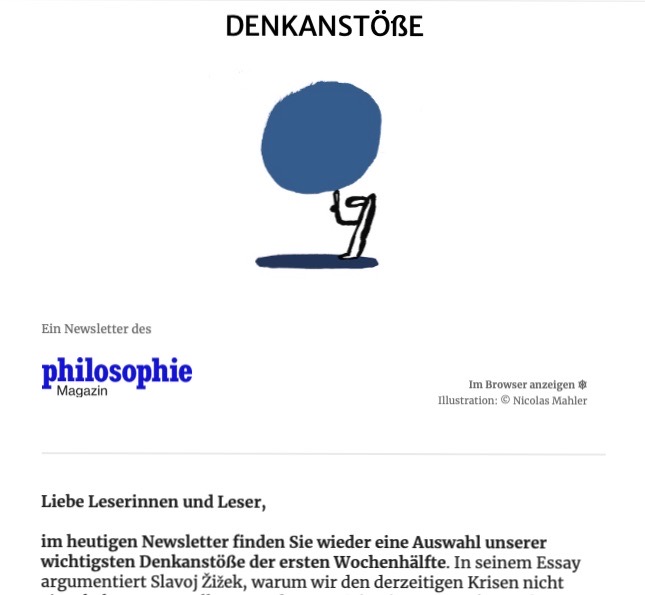

 ein erfolgreicher Bestseller des Philosophen und Kulturtheoretikers
ein erfolgreicher Bestseller des Philosophen und Kulturtheoretikers 

 Man muss keine radikale Feministin sein, um eines klarzustellen: Ohne das Wissen der Frauen wäre die Welt, in der wir heute leben, undenkbar. Seit der Antike haben Frauen über Metaphysik, Ethik, Naturphilosophie, Gesellschaft und Politik nachgedacht und geschrieben. Der Geist, er hat kein Geschlecht – die Denker freilich, sie haben ein solches sehr wohl. Wir denken uns „den Philosophen“ aber unweigerlich als männlich, meint Catherine Newmark, die Chefredakteurin der Sonderausgabe
Man muss keine radikale Feministin sein, um eines klarzustellen: Ohne das Wissen der Frauen wäre die Welt, in der wir heute leben, undenkbar. Seit der Antike haben Frauen über Metaphysik, Ethik, Naturphilosophie, Gesellschaft und Politik nachgedacht und geschrieben. Der Geist, er hat kein Geschlecht – die Denker freilich, sie haben ein solches sehr wohl. Wir denken uns „den Philosophen“ aber unweigerlich als männlich, meint Catherine Newmark, die Chefredakteurin der Sonderausgabe  enn man die Idee des geeinten Europas nicht fallen lässt, darf man hoffen, dass eines Tages auch das Ideal der globalen friedlichen „Weltbürgergemeinschaft“ Wirklichkeit wird”. Dieses Plädoyer stammt aus Jürgen Habermas’ Essay “Zur Verfassung Europas”, der bereits 2011 bei Suhrkamp erschien.
enn man die Idee des geeinten Europas nicht fallen lässt, darf man hoffen, dass eines Tages auch das Ideal der globalen friedlichen „Weltbürgergemeinschaft“ Wirklichkeit wird”. Dieses Plädoyer stammt aus Jürgen Habermas’ Essay “Zur Verfassung Europas”, der bereits 2011 bei Suhrkamp erschien. Wahnsinn, Gefängnis, Sex – die Themen, die sich Michel Foucault vornahm, sie kamen nicht aus dem Zentrum des philosophischen Kanons. Und doch zielte Foucault mit seinen historischen Untersuchungen über Randständiges ins Herz der Philosophie, denn seine Fragen gingen aufs große Ganze: Wie haben sich unser Denken, unsere Methoden der Wissenschaft, unsere Vorstellung von Vernunft, Wahrheit, Normalität oder persönlicher Identität überhaupt entwickelt, was ist ihre Geschichte?
Wahnsinn, Gefängnis, Sex – die Themen, die sich Michel Foucault vornahm, sie kamen nicht aus dem Zentrum des philosophischen Kanons. Und doch zielte Foucault mit seinen historischen Untersuchungen über Randständiges ins Herz der Philosophie, denn seine Fragen gingen aufs große Ganze: Wie haben sich unser Denken, unsere Methoden der Wissenschaft, unsere Vorstellung von Vernunft, Wahrheit, Normalität oder persönlicher Identität überhaupt entwickelt, was ist ihre Geschichte? Dass Philosophie zusehends im Alltag Einzug hält, ist mehr als nur eine Wunschvorstellung von mir. Freili
Dass Philosophie zusehends im Alltag Einzug hält, ist mehr als nur eine Wunschvorstellung von mir. Freili Im Herzen der modernen Körperfixierung wohnt ein uraltes philosophisches Problem: Wie lässt sich das Verhältnis von Leib und Seele denken? Bestimmt der Geist den Körper – oder umgekehrt? Einige der wichtigsten Positionen – etwa von Epikur, Platon, Kant oder Schopenhauer finden sich im Heft. Außerdem ein Plädoyer gegen den Körperkult von der Journalistin und Literaturkritikerin Marianna Lieder „Ein gesunder Geist braucht keinen gesunden Körper“ und noch vieles mehr.
Im Herzen der modernen Körperfixierung wohnt ein uraltes philosophisches Problem: Wie lässt sich das Verhältnis von Leib und Seele denken? Bestimmt der Geist den Körper – oder umgekehrt? Einige der wichtigsten Positionen – etwa von Epikur, Platon, Kant oder Schopenhauer finden sich im Heft. Außerdem ein Plädoyer gegen den Körperkult von der Journalistin und Literaturkritikerin Marianna Lieder „Ein gesunder Geist braucht keinen gesunden Körper“ und noch vieles mehr.