Schäm dich! Robert Pfaller über das neue Statussymbol unserer Pseudo-Correctness
Die Aussage “Schäm dich” mutierte zur Kampfansage
Hier gibt es eine Scham, die mit Stolz formuliert wird, meint Pfaller im Standard-Interview: “Die Scham ist das geworden, was man in der Soziologie ein Distinktionsgut nennt, vergleichbar einer teuren Handtasche. Man ist stolz, Scham für den anderen empfinden zu können. Dadurch deklariert man sich als etwas Besseres, Feineres. Und man versucht, den anderen mundtot zu machen”.
 Wir sind aber trotzdem keine Schamgesellschaft, denn “… Schamkulturen wie etwa die japanische oder die der alten Griechen kennen nicht nur das Gebot, dass man sich keine Blöße geben darf, sondern zur Scham gehört noch ein zweites Gebot, nämlich das, über Blößen anderer gnädig hinwegzusehen, und stattdessen so zu tun, als hätte man sie nicht bemerkt”, das könnte man das Diskretionsgebot der Scham nennen, so der Philosoph und beklagt: “Wir in unserer Pseudo-Schamkultur verhalten uns da anders – wir sind zwar sehr schamempfindlich, aber sobald wir Scham empfinden, zeigen wir mit nackten Fingern auf angezogene Menschen, was eigentlich sehr schamlos ist.”
Wir sind aber trotzdem keine Schamgesellschaft, denn “… Schamkulturen wie etwa die japanische oder die der alten Griechen kennen nicht nur das Gebot, dass man sich keine Blöße geben darf, sondern zur Scham gehört noch ein zweites Gebot, nämlich das, über Blößen anderer gnädig hinwegzusehen, und stattdessen so zu tun, als hätte man sie nicht bemerkt”, das könnte man das Diskretionsgebot der Scham nennen, so der Philosoph und beklagt: “Wir in unserer Pseudo-Schamkultur verhalten uns da anders – wir sind zwar sehr schamempfindlich, aber sobald wir Scham empfinden, zeigen wir mit nackten Fingern auf angezogene Menschen, was eigentlich sehr schamlos ist.”
Das rühre zunächst daher, dass wir uns in einer Schuld-Kultur befänden, in der Menschen die Scham nicht als handlungsleitendes Prinzip für sich selber betrachten, weshalb sie sich nicht verschämt solidarisch mit anderen verhalten und den Anschein wahren, sondern stattdessen mit der nackten Peinlichkeit herausplatzen. Das zweite Problem, warum Menschen mit der Scham so wenig anfangen können, liege daran, dass viele Menschen ihre Zukunftsperspektiven verloren haben. Viele haben das Gefühl, sich morgen ihr Leben nicht mehr leisten zu können. Die Spirale nicht erreichbarer Ideale wird dann also als beschämend und kränkend empfunden. “Vielleicht würde es helfen, die Propaganda zu durchbrechen, die von Menschen fordert, das zu werden, was man sei.” Das verhindere nämlich, Stolz oder Ehre zu empfinden. Die würden wir nämlich nur dann empfinden, wenn wir `ein bisschen besser wären´als wir wirklich sind.
S. Fischer Verlag
ISBN: 978-3-10-397137-8

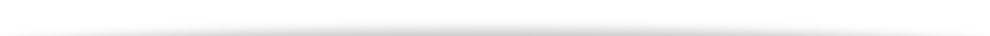
 Hier sind zwei Buchtipps. Den ersten kann ich meinen (nicht nur ganz jungen) Lesern empfehlen: Selina Seemann ist Slam-Poetin und Wortakrobatin – sie lebt im Netz und bringt viele Alltagsphänomene selbstironisch, nachdenklich und teilweise fast kabarettistisch lustig auf den Punkt. Alles kleingedruckt, im Twitterstil und souverän in der Wirkung. Beispiele gefällig?
Hier sind zwei Buchtipps. Den ersten kann ich meinen (nicht nur ganz jungen) Lesern empfehlen: Selina Seemann ist Slam-Poetin und Wortakrobatin – sie lebt im Netz und bringt viele Alltagsphänomene selbstironisch, nachdenklich und teilweise fast kabarettistisch lustig auf den Punkt. Alles kleingedruckt, im Twitterstil und souverän in der Wirkung. Beispiele gefällig? Ganz anders und nicht minder bestechend kommt der neue Gedichtband der Lyrikerin Judith Zander daher:
Ganz anders und nicht minder bestechend kommt der neue Gedichtband der Lyrikerin Judith Zander daher:

 Es gibt Dinge, die einem so am Herzen liegen, dass man sich nicht drüber traut. Dass man sie auf später verschiebt. Die Zeit ist noch nicht reif genug, sagt man sich; der Respekt davor ist zu groß. In Wahrheit wähnt man sich unvorbereitet, man ist noch nicht gut oder klug genug, um sich heranzutasten, geschweige denn sich tief einzulassen.
Es gibt Dinge, die einem so am Herzen liegen, dass man sich nicht drüber traut. Dass man sie auf später verschiebt. Die Zeit ist noch nicht reif genug, sagt man sich; der Respekt davor ist zu groß. In Wahrheit wähnt man sich unvorbereitet, man ist noch nicht gut oder klug genug, um sich heranzutasten, geschweige denn sich tief einzulassen.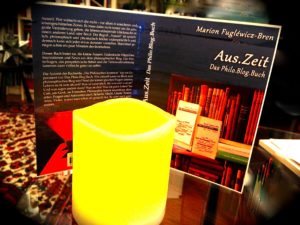

 Schenken Sie sich und anderen ein Privileg, das wir uns vielleicht öfter leisten sollten: Nachfragen, Differenzieren, Zuhören. Oder Lesen! …
Schenken Sie sich und anderen ein Privileg, das wir uns vielleicht öfter leisten sollten: Nachfragen, Differenzieren, Zuhören. Oder Lesen! …




 Wie beurteilen Philosophen die derzeitige Corona-Krise?
Wie beurteilen Philosophen die derzeitige Corona-Krise? Die Coronakrise und der Umgang damit sei “für jeden von uns eine ganz außergewöhnliche Situation”, so Konrad Paul Liessmann im Interview mit dem
Die Coronakrise und der Umgang damit sei “für jeden von uns eine ganz außergewöhnliche Situation”, so Konrad Paul Liessmann im Interview mit dem  Flaßpöhler: “Wir sind in einer Situation, wo man immer beide Seiten sehen muss. Es gibt zum einen eine sehr negative, fast regressive Seite dieser Krise. Wir ziehen uns immer mehr zurück – nicht nur im Nationalen, sondern auch im Privatraum. Wir nehmen nicht mehr am Kulturleben teil. Es gibt aber auf der anderen Seite auch ganz positive Effekte, und da hilft es, in die Philosophie zu schauen. Philosophen wie Martin Heidegger oder Blaise Pascal haben immer betont, dass das öffentliche Leben immer auch eine Art von Ablenkung, von Flucht ist, und dass dieses Zurückgeworfensein und die Tatsache, dass man Stille und Nichtstun aushalten muss, immer mit einem Erkenntnisgewinn einhergeht. Insofern glaube ich, dass diese Krise auch Denkräume eröffnen kann – und zwar nicht nur in existenziell-privater Hinsicht, sondern auch in politischer Hinsicht”.
Flaßpöhler: “Wir sind in einer Situation, wo man immer beide Seiten sehen muss. Es gibt zum einen eine sehr negative, fast regressive Seite dieser Krise. Wir ziehen uns immer mehr zurück – nicht nur im Nationalen, sondern auch im Privatraum. Wir nehmen nicht mehr am Kulturleben teil. Es gibt aber auf der anderen Seite auch ganz positive Effekte, und da hilft es, in die Philosophie zu schauen. Philosophen wie Martin Heidegger oder Blaise Pascal haben immer betont, dass das öffentliche Leben immer auch eine Art von Ablenkung, von Flucht ist, und dass dieses Zurückgeworfensein und die Tatsache, dass man Stille und Nichtstun aushalten muss, immer mit einem Erkenntnisgewinn einhergeht. Insofern glaube ich, dass diese Krise auch Denkräume eröffnen kann – und zwar nicht nur in existenziell-privater Hinsicht, sondern auch in politischer Hinsicht”.  Der Philosophie-Professor Heinz-Ulrich Nennen (er lehrt am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), rät zur Gelassenheit. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die philosophische Psychologie.
Der Philosophie-Professor Heinz-Ulrich Nennen (er lehrt am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), rät zur Gelassenheit. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die philosophische Psychologie.