Alles wird gut. Zur Dialektik der Hoffnung beim Philosophicum Lech
Ange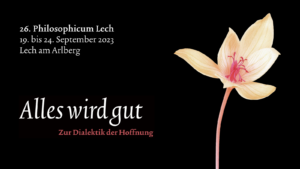 sichts einer krisengeschüttelten Welt, in der sich Nachrichten über Klimakatastrophen, Kriege, zusammenbrechende Versorgungssysteme und Pandemien überbieten, scheint kein Platz mehr für jene Hoffnungen, die sich in optimistischen Erwartungen, lichtvollen Utopien und Visionen vom ewigen Frieden zeigten.
sichts einer krisengeschüttelten Welt, in der sich Nachrichten über Klimakatastrophen, Kriege, zusammenbrechende Versorgungssysteme und Pandemien überbieten, scheint kein Platz mehr für jene Hoffnungen, die sich in optimistischen Erwartungen, lichtvollen Utopien und Visionen vom ewigen Frieden zeigten.
Unter dem Titel „Alles wird gut. Zur Dialektik der Hoffnung“ werden vom 19. bis 24. September renommierte Vortragende die Thematik so tiefgreifend wie breitgefächert erörtern und mit dem Publikum diskutieren. Die ganze Zwiespältigkeit und Dimension einer grundlegenden Haltung und Emotion vor dem Hintergrund unserer krisengebeutelten Welt steht im Fokus des 26. Philosophicum Lech.
Was dürfen wir hoffen? Immanuel Kants berühmte Frage müsste heute umformuliert werden, konstatiert Konrad Paul Liessmann in seinem Editorial: Dürfen wir überhaupt noch hoffen? Inwieweit die Optimismus beschwörende Formel ihre Berechtigung hat oder ironisch verstanden werden sollte, wird sich weisen.
Mehr dazu weiter unten und später – wie immer an dieser Stelle.
WEITERLESEN
“Hoffnung war immer schon ein zweischneidiges Schwert. Hoffnung ist das, was bleibt, wenn nichts mehr getan werden kann. Hoffnung ist das Eingeständnis eines Scheiterns, das nur noch auf das Unverfügbare setzen kann: auf ein Wunder. Hoffnung ist aber auch das, was uns in finsteren Zeiten aufrecht hält und an eine Zukunft glauben lässt. Hoffnung kann ein schwacher Trost für Menschen sein, die man aufgegeben hat, Hoffnung kann jedoch dem Kraftlosen den Mut zum Weiterleben ermöglichen. Hoffnung kann zur Untätigkeit verurteilen, Hoffnung kann zur Aktivität anstacheln, Hoffnung kann die Fügsamkeit befördern, sie kann den Willen zum Widerstand entfachen. Für gläubige Christen ist die Hoffnung neben dem Glauben und der Liebe sogar eine göttliche Tugend. Doch dort, wo wirklich alles verspielt ist, gilt der Imperativ, mit dem Dantes Hölle die Neuankömmlinge empfing: Lasst alle Hoffnung fahren.
Einerseits ist das Leben des modernen Menschen von Hoffnungen grundiert, einem Fortschrittsglauben in Hinblick auf neue Technologien wie Künstliche Intelligenz oder auch in Zuversicht auf einen positiven gesellschaftlichen Wandel hin zu Gerechtigkeit und Gleichberechtigung sowie zur schnellstmöglichen Erreichung der Klimaziele. Andererseits werden die Hoffnungen von dystopischen Ängsten und Befürchtungen konterkariert, die aus unterschiedlichsten Beweggründen oft befeuert werden.
„Wie begründet unsere Hoffnungen sind oder ob sie uns in die Irre leiten und zu einem falschen, getrübten Blick auf die Welt führen, ist deshalb Gegenstand heftiger Debatten“, so Liessmann.
Namhafte Vortragende aus Philosophie, Sozial- und Kulturwissenschaften sowie benachbarten Disziplinen unterziehen die Thematik einer umfänglichen transdisziplinären Betrachtung in Bezug zu aktuellen Entwicklungen und mit anschließender Publikumsdiskussion.

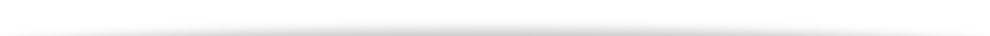
Hinterlasse einen Kommentar
Wollen Sie an der Diskussion teilnehmen?Wir freuen uns über ihren Beitrag !